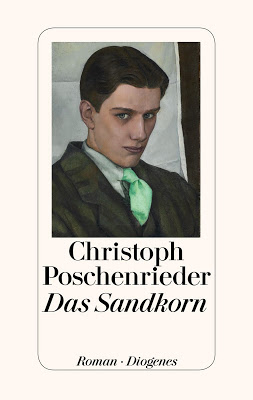erste Weltkrieg bald ein Jahr andauert zieht am 06. Juni 1915 ein
junger, gut gekleideter Mann durch die Straßen Berlins zwischen Tiergarten und
Landwehrkanal. Er bleibt nicht lange alleine, denn was er tut, ist
ungewöhnlich: ein Griff in die Jackentasche, ein Säckchen kommt zum Vorschein,
dessen Inhalt der Unbekannte herausrieseln lässt. Sand ist es, den er,
nicht ohne gemurmelte Worte, Zaubersprüchen gleich, mit dem Berliner Sand
vermischt.
Sein Tun ist
methodisch, der eingeschlagene Weg zielgerichtet. Der Inhalt der Säckchen ist
immer unterschiedlichen Aussehens. Je weiter der junge Mann geht, desto mehr
Menschen folgen ihm. In diesen Zeiten aber sind größere Menschenansammlungen
suspekt. Kurz bevor der Ausgangspunkt, der auch das Ende des Weges markiert,
erreicht ist, setzt ein Schupo dem Treiben ein Ende.
„ … Wie
kommen Sie dazu, hier Säckchen fremdländischen, um nicht zu sagen, feindlichen
Inhalts auszuleeren? …“ Seite 15
Soweit ist es
also schon im Kaiserreich: Sandkörner werden als feindlich eingestuft, weil sie
dem früher verbundenen, nun aber verfeindeten italienischen Boden entstammen.
Dem Schupo kann der Fremde nur mit einer Gegenfrage antworten.
„ … Ja, wie
komme ich dazu. …“ Seite 16
In der roten
Burg wird er, Jacob Tolmeyn – mit c und y – aus Berlin, Kommissar von
Treptow langsam und bruchstückhaft anvertrauen, was es auf sich hat mit dem
Sand. Er erzählt die Geschichte von Fritzi und Niki, ohne tatsächlich von
diesen beiden zu sprechen.
Aus verschiedenen
Blickwinkeln, über Zeiten und Ebenen hinweg hat Christoph
Poschenrieder eine perfekte Geschichte erschaffen. Eine jener raren
Geschichten, die ein Tor öffnen in eine andere Zeit, in eine Welt, die
längst vergangen so lebendig wird, dass man nur einen Schritt gehen muss, um
ein Teil von ihr zu werden. Vom Anfang bis zum Ende hat er sie gründlichst
durchdacht, klug aufgebaut, brillant strukturiert. Ohne die einzige Anmutung
von Konstruktion.
Die erste
Reise, mit dem Ziel steinerne Zeugen der Zeit Kaiser Friedrichs in Italien zu
verzeichnen und zu vermessen, tritt der junge Kunsthistoriker Tolmeyn noch
alleine an. Auf der zweiten Reise, die die Erkenntnisse der ersten vertiefen
soll, wird ihm ein junger aus der Schweiz stammender Kollege, Beat Imboden, zur
Seite gestellt, den er anfänglich abschätzig als Assistenten bezeichnet, jedoch
immer mehr schätzen lernt.
Seine
Heimatstadt Berlin offiziell wegen dieser Aufgabe verlassen zu müssen ist ein
Glücksfall für Tolmeyn, lässt er dort doch Kreise zurück, in denen man sich
aufgrund des Paragraphen 175, der gleichgeschlechtliche Liebe unter
Höchststrafe stellt, besser nicht bewegen sollte.
Poschenrieder
beschreibt die Situation der Gemeinde der damals Freundlinge genannten
Männer sehr atmosphärisch. Zwar gab es sogar Gerüchte um die Berater
einer Majestät des Kaisers und deren sexuelle Neigungen, doch das tatsächliche
homosexuelle Leben konnte nur im Dunkeln, gar im Zwielicht stattfinden.
In Italien
hingegen fühlt sich Tolmeyn frei. Er genießt es, diese zweite Reise gemeinsam
mit Imboden zu erleben. Sein Hang zum guten Leben, zur Extravaganz
ist nur menschlich. In seiner teilweise aufblitzenden Maßlosigkeit wirkt er
äußerst anziehend und charmant, obwohl er durchaus arrogant sein kann. All das
verhindert eine keimende Freundschaft zwischen Imboden und ihm nicht –
abtastend begibt er sich immer wieder in den Treibsand der Gefühle – doch
schafft er es nicht, Imboden aus der Reserve zu locken.
Der Krieg ist
ausgebrochen, Imboden, der aus einer Familie mit langer militärischer Tradition
stammt, schließt sich der Fremdenlegion an, Tolmeyn kehrt zurück nach Rom, von
wo sie die zweite Reise begonnen hatten …
Innere
Gefühlswelten, die nur zeitweise durch die äußeren Zwänge
eingeschränkt bleiben können, politische und gesellschaftliche
Ereignisse, die Lebenslinien unterschiedlicher Personen, all das
verschmilzt Poschenrieder auf eleganteste Art und Weise. Das Schicksal
verschiedener Personen wird zu einem einzigen. Wie bei einer Farbaufnahme setzt
er aus den drei Phasen Blau, Grün und Rot ein realistisches und sehr farbiges
Bild der Zeit, der Gesellschaft und der Menschen zusammen. So geschickt, dass
es keinerlei Brüche im Text gibt. Diese Geschichte liest sich wie aus einem
Guss. Trotz der unterschiedlichen Ebenen, Zeiten, Blickwinkel. Dass sie
sicherlich mit der größten Sorgfalt aufgebaut wurde, merkt man ihr in keiner
Sekunde an.
Wollte man
einen Text haptisch erfassen, so wäre Das Sandkorn reine Seide: fließend
und anschmiegsam, im Griff kühl und warm zugleich, perfekt fallend, nie
einengend und von allen Seiten elegant schillernd.
Feinste literarische Seide eben.